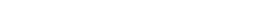Transformation und die Idee, diese Mammutaufgabe der Energiewende bildlich darzustellen, hat uns, den ausrichtenden Unternehmerverband Sachsen e.V., in die Halle 14 der Baumwollspinnerei gebracht. „From Cotton to Culture“ ist der Prozess, der die alte große Fabrik in den letzten 30 Jahren ausgemacht hat.
Den Unternehmerverband Sachsen e.V. gibt es auch seit 30 Jahren, eine Notwendigkeit der Gründerunternehmer, sich gemeinsam am neuen Markt – durchaus auch gegen die Treuhandanstalt – zu behaupten. Nicht erst jetzt erheben die ostdeutschen Unternehmerverbände für die neuen Energieformen und Möglichkeiten erneut gemeinsam ihre Stimme; mit Dank und Freude konnten wir das in einer Gesamtkonzeption erarbeiten und moderieren.
Nun zum 10. Mal das OEF an anderem Ort; bunter, jünger, komplexer, notwendiger denn je. Mit den wesentlichen Themen, die die gesamtdeutsche Politik zu den anstehenden Themen der Koalitionsverhandlungen wesentlich interessieren müssen! https://youtu.be/7f6uAlJ8RJM Wie twitterte unser MP Michael Kretschmer „der Hotspot der Energiewende“. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an.
Wir haben in den letzten zehn Jahren viel geschafft: Angleichung der Netzentgelte, Artikulierung der Interessen des ostdeutschen Mittelstands, Austausch zwischen Politik, Energiewirtschaft und Wissenschaft! Der Diskurs muss aber weitergehen und im Jahr der Bundestagswahl wollen wir erneut die Weichen stellen. Die Transformationserfahrungen der Nachwendezeit verschaffen Ostdeutschland einen Vorteil. Wir bleiben dran!