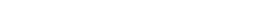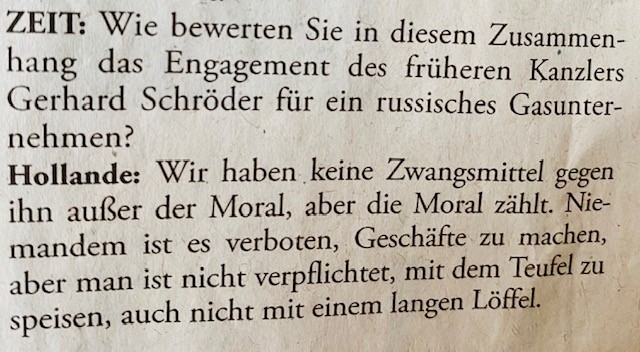Das vergangene Jahr hat wieder Spuren hinterlassen, wer blickt noch durch, wer hat die Energie und Kraft und Möglichkeit, sich Zeit zu nehmen zum sortieren, einordnen, umsetzen?
Ich wäre keine gute Kauffrau, würde ich meine Expertise dazu nicht anbieten. Komplexe Themen erfordern den erfahrenen strukturierten Blick, der das Projekt in die zielgerichtete Umsetzung bringt, also gerne fragen Sie mich – wie gewohnt.
Erkennen müssen wir in den festgefahrenen Strukturen und systemisch vorgegebenen Abläufen aber doch viel mehr und das treibt uns alle bis hin zur mangelnden demokratischen Auseinandersetzung in Sorge um.
Im ablaufenden Jahr müssen wir allerorten feststellen, dass die Diskussionen innerhalb gebotener Abwägung und gesellschaftlicher Formate sich weiter eingeengt haben und Menschen noch absoluter, ja fast radikal miteinander umgehen. Das gilt für viele Bereiche in Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Bürgerbeteiligungen überschlagen sich in übereilten und in Worthülsen gekleideten Formaten ohne Rahmen und Zieldefinition mit den vorhandenen demokratischen Instrumentarien. Politische Debatten werden unnötig hektisch und unfair verkürzt geführt, Projekte werden ziellos und ineffizient geleitet, Entscheidungen mangels Leadership, Mut und Kompetenz nicht gefällt. Rückzug in ewigen Abwägungsprozessen, mangelndem Entscheidungswillen oder -Können führen zu Ineffizienz und Unproduktivität.
Folge: Verwaltungen in Management, Politik und öffentlich- rechtlicher Verwaltung werden aufgebläht, statt projektsteuernd gestrafft. „Entbürokratisierung“ kann nicht erfolgen. Verlierer ist die Zivilgesellschaft und der Macher, der gestalten will und kann – mit eigenem Kopf, Geld und Risiko, noch als Mittelständler bekannt. Deutschland überaltert altersunabhängig im Kopf.
Da werden junge Menschen im Ausüben zivilen Ungehorsams, über deren Maßnahmen zwischen Kunstschändung und Klebetests man in strafrechtlicher Relevanz man sicherlich streiten muss, als „Klima – RAF“ und die Krisen der Welt als „Autos wie bei einer Massenkarambolage“ bezeichnet. Letztere ältere Weltakteure mit Vorbildfunktion für die jungen Weltbürger wundern sich dann über die ernannte Aussichtslosigkeit der Jugend im verzweifelten Ungehorsam. Es heißt nicht umsonst „den Worten folgen Taten“.
Liegen bleibt die Effizienz, der Mut und die Entschlossenheit es besser zu machen. In Gefahr gerät das demokratische System im Bemühen, nicht gegen, sondern mit der eigenen Zivilgesellschaft zu gestalten. Große Bevölkerungsgruppen wenden sich ab ohne erkennen zu wollen, dass sie das von sich selbst, dem Volk/ Souverän tun. Nicht nur schade, sondern mit verheerender Auswirkung und natürlich auch Grund für den Rückzug aus der gesellschaftlichen Eigenverantwortung ist dabei auch die allseitige gesellschaftliche, berufliche – auch die mediale Berichterstattung, indem sich alle auf dieselben superaktuellen Themen stürzen ohne den Dingen kontrovers und unter Außerachtlassung anderer politischer Notwendigkeiten im öffentlichen Diskurs auf den Grund zu gehen. Wir merken es doch überall, wenn aus allen Gruppen der Gesellschaft zu hören ist „man darf ja nichts mehr sagen, sonst ist man gleich grün-links versifft links oder Nazi“.
Aktuell kommt das schreckliche Geschehen in Israel, im Nahen Osten dazu – für Israel – gegen Palästina oder umgekehrt. Dann ist man entweder Muslimfreund und Antisemit oder eben Judenfreund und natürlich gegen Moslems. Wir erschrecken alle angesichts des herausbrechenden Antisemitismus auch in unserem Land; Grund aufzustehen und sich einzumischen. HALTUNG zeigen und informiert sein. Auch sagen, dass man sich kein Urteil erlauben möchte, egal aus welchen Gründen, sei es die mangelnde Kenntnis oder auch die eigene Erkenntnis, den Konflikt nicht einordnen zu können. Auch Schweigen ist eine Meinung!
Dazwischen scheint es, weicht man argumentativ vom vorgebeteten Mainstream ab, nichts zu geben. Abwägungen und gut durchdachte Überlegungen zu einzelnen Themen, die innerhalb komplexer Zusammenhänge erarbeitet werden müssen, werden als Schwäche oder Zögerlichkeit oder „menschliches Auslaufmodell“ abgetan. Das schnelle Wort, die unüberlegte und dann leider auch ungebildete und dem Empfänger gegenüber respektlos hingeworfene Mail oder Äußerung in den sozialen Medien, „Management by Headset“ in Eile und unvollkommene dauernde Erreichbarkeit ohne Tiefgang hat gebildetes und überlegtes Handeln überholt. Das gilt in allen Bereichen unseres Lebens. In Hektik gedeihen Fehler, respektvoller Umgang geht verloren wie auch der Blick fürs Ganze.
Mein Plädoyer: Lassen Sie uns überlegt und belesen in Wissen und Respekt miteinander reden und gemeinsam gestalten! Die Welt ist bunt, zzt. mit vielen Graustufen, aber Pessimismus und apokalyptisches Tönen hilft uns aus den Krisen nicht heraus.
In diesem Sinne: bleiben Sie stabil und gesund und kommen Sie gut in das Frühjahr. Bleiben wir im respektvollen Diskurs miteinander!